(M)ein Jubiläum oder: wie ich Wissenschaft erlebte
Ein Text vom Frühjahr 2013
Wolfgang Näser, Marburg
War das ganze Leben eine Suche nach Wahrheit, Liebe und Schönheit
und ist es am Ende auch nur ein wenig gelungen, diese zu erschließen,
dann hat es sich gelohnt, Wacken und Klötze wegzuräumen
und auch mal tiefe Täler zu durchschreiten.
Hier geht es weder um eine wissenschaftliche Theorie
noch zitiere ich Koryphäen und sonstige "Leuchttürme", und dennoch
haben meine Erinnerungen und Reflexionen viel zu tun mit Wissenschaft, mit
meinem (manchmal verschlungenen) Zugang zu ihr und mit der Universität,
der ich viel verdanke, hat sie doch mein Leben entscheidend geprägt,
und deshalb gehört dieser Text in meine Uni-Homepage hinein, deren
Gewährung ich wiederum dem Marburger Hochschul-Rechenzentrum verdanke,
vor dessen Mitarbeiter/innen ich mich verneige.
Es war am 22. Dezember 1972, als ich, zusammen mit der Protokollantin,
an einem klirrend kalten Winternachmittag Professor Josef Kunz in
Hofheim / Taunus besuchte. Bei Kaffee und Kuchen prüfte er mich eine
halbe Stunde lang über
Franz
Kafka und die deutsche Novelle. Das war der Schlußteil meines
Rigorosums
(es gab noch nicht die Renaissance der Disputatio), das einen Tag zuvor mit
den jeweils einstündigen Examina bei den Professoren Kurt Otten
(Anglistik) und L.E. Schmitt begonnen hatte. Danach gingen wir in
den ersten Stock, Prof. Kunz zeigte uns seine elektrische Orgel, und wir
fuhren im Dunkeln nach Marburg zurück. Hinten im Kofferraum meines schon
mit UKW-Funk ausgestatteten Fiat 128 lagen, unter einer Decke, die ersten
5 frisch gedruckten Exemplare meiner Diss., deren erstes Exemplar ich, ganz
nach Plan, meinen Eltern unter den Weihnachtsbaum legen konnte.
Nun sind 40 Jahre vergangen - manchmal denke ich: wie ein Windhauch, dann
wiederum wird bewußt, wie voll gepackt diese vier Dekaden doch waren.
Die Rückschau auf diese Periode und die weiter davor liegende Zeit offenbart
einen etwas verschlungenen, zum Teil auch steinigen Weg, der zur Uni Marburg
führte, schließlich zur Promotion, zu fast 37 Jahren im Deutschen
Sprachatlas und zu 35 Jahren universitärer Lehre.
Mit 17 Jahren Abitur, mit 21 Jahren Examen und kurz darauf Doktor, nein,
das kann ich nicht vorweisen. Kurz nach dem 21. Geburtstag hatte ich erst
meine 18 Monate Bundeswehr hinter mir, die mir zwar viele wichtige
Lebenserfahrungen vermittelt, mich aber intellektuell gesehen um mindestens
ein Jahr zurückgeworfen hatten. In der gegenwärtigen
Bildungs-Diskussion wird dann und wann behauptet, Armut oder "eine falsche
Familie" seien Hinderungsgründe für gymnasiale oder gar
universitäre Bildung und damit einen entsprechenden sozialen Aufstieg.
Nun, dann war ich offenbar unter sehr ungünstigen Bedingungen aufgewachsen:
in einer Kleinstadt (Arolsen) mit gerade 5000 Einwohnern und als (einziges)
Kind von Eltern ohne Abitur, und es gab keinen akademischen "Hintergrund",
der so oft beschworen wird bei den bisweilen als "Alpha"-Menschen hochgelobten
Früh-Karrierist/innen. Mit 17 ging ich ganz normal zur Schule, gab viele
Nachhilfestunden, erkundete das Waldecker Land per Fahrrad, bastelte mit
Widerständen und Röhren und half meinen Eltern in unserem kleinen
Geschäft. Auch arbeitete ich mal für etwas mehr Taschengeld in
einem Betonsteinwerk. Kurz vor dem Abitur (das ich als einer der Besten bestand)
verlegte ich im Keller unseres neu erbauten Hauses die gesamte
Elektro-Installation. Wissenschaftliche Arbeitsweisen und Theorien? Konnten
mir meine Eltern nicht vermitteln, doch, und das schätze ich noch heute
als viel essenzieller, konnten sie mir zeigen, wie man mit Fleiß etwas
erreicht, und sie konnten mir Liebe geben.
 Alle wichtigen Anregungen und Impulse
erhielt ich an der
Christian-Rauch-Schule
in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.
Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von
kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der
anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich
Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer
schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl
und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich
vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer
Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen
und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines
Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals
für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen
obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen
Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit
viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur
führte.
Alle wichtigen Anregungen und Impulse
erhielt ich an der
Christian-Rauch-Schule
in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.
Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von
kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der
anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich
Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer
schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl
und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich
vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer
Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen
und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines
Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals
für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen
obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen
Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit
viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur
führte.
Ich wollte Englisch und Französisch für das Lehramt studieren,
und dann, kurz nach dem Abitur, wurde ich einberufen und, wie ein Stück
Vieh, mit meinen Leidensgenossen auf einem Lastwagen vom Hauptbahnhof
zur Göttinger Ziethen-Kaserne transportiert; kurz darauf traf dort der
zerstückelt entwertete Marburger Studentenausweis ein, zum Heulen.
Alles andere hatte ich in jenen achtzehn Monaten getan außer studieren
und / oder mich mit wissenschaftlichen Theorien und Arbeitsweisen zu
beschäftigen, hatte genug zu tun gehabt mit der (schließlich
gelungenen) Anpassung an die aus verschiedensten Schichten und Lebensbereichen
kommenden Kameraden, bis zuletzt hatte ich mit fünf anderen in einer
"Stube" zugebracht und dann dem Panzerbataillon 44 Ade gesagt.
Obzwar sie mich wie nichts anderes entwöhnte von Atmosphäre und
Technik des schulischen Lernens und insofern den Übergang zur
Universität erschwerte, war und bleibt die Bundeswehrzeit für mich
eine wichtige Periode der Selbstfindung und vieler guter Erfahrungen im
praktischen Leben. Als ich von ihr Abschied nahm, hätte man mir das
Zeugnis der Reife jetzt mit einigem Recht geben können.
 Zum Wintersemester 1964/65
wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten
Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für
ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik
immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll
auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen
Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.
Zum Wintersemester 1964/65
wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten
Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für
ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik
immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll
auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen
Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.
Intellektuell gesehen erschien der Studienbeginn wie ein Sprung ins kalte
Wasser. Zunächst einmal galt es herauszufinden, was das viel verwendete
"relevant" bedeutet, dann, was, literarisch gesehen, man unter "interpretieren"
versteht. Ein als Tutor arbeitendes höheres Semester zeigte uns die
unermeßlich scheinenden Bestände der altehrwürdigen
germanistischen Bibliothek "Am Plan" in Marburg. Knarrende Dielen, Regale
mit einer Unzahl geheimnisvoller Signaturen. Oben, im ersten Stock, waren
die Zimmer des Ordinarius und der Assistenten; ab und zu ging einer nach
draußen und genoß die frische Luft.
Würde ich dort jemals heimisch werden? War ich hier, in der
Geisteswissenschaft zu Hause? Wo ich doch, an den Wochenenden in Arolsen,
lieber an elektrischen Schaltungen werkelte, meinen selbstgebauten
NF-Verstärker und einen kleinen Mittelwellensender zu verbessern suchte?
Und zwischendurch, in den Semesterferien, immer wieder zwei oder drei Monate
Vollzeit beim Suchdienst, wo ich es mit Fleiß und Können zum
höchstbezahlten Studenten brachte, der kurzzeitig in der
Übersetzergruppe in englischer und französischer Korrespondenz
die Arbeit zweier kranker Kolleg/innen mit erledigte und eine 170 Seiten
lange Übersetzung des in der "Times" abgedruckten Prozesses
"Dering
vs. Uris" fertigte. Im Suchdienst, dessen Atmosphäre und Arbeit
mir so gut gefielen, daß ich allen Ernstes in Erwägung zog, dort
zu bleiben, bis mir der gütige Direktor zu verstehen gab, es sei doch
besser, das Studium fortzusetzen.
Und so reichte nun meine Bandbreite von der tragischen Größe im
"Prinzen von Homburg" bis zum Problem der Ankopplung des Schirmgitters bei
der AG2-Modulation eines Kurzwellensenders, von der
Handlungsführung im "Joseph Andrews" bis zur Entbrummung im Heizkreis
des "Magnetophons KL 65 KS", von Problemen der Förderstufendidaktik
bis zur Effektivität eines Öldruck-Ausgleichsbehälters im
Mororraum meines mittlerweile zehnjährigen Fiat 600. (Erinnerungen,
1987)
Die zwei Seelen in meiner Brust, nämlich die Liebe zu den Sprachen und
der Hang zum Technisch-Ingenieurmäßigen, waren im Sommer 1966
so heftig in Widerstreit geraten; daß ich nach vergeblichen
Bemühungen, den Sinn des Spekulativen in der Geisteswissenschaft
nachzuvollziehen, nicht wenig Lust verspürt hatte, diesem Studium den
Rücken zu kehren. Andererseits gab es manch interessante und, aus
späterer Sicht exotisch erscheinende Lehrveranstaltung, so vermittelte
uns im SS 1965 der Gießener Lehrbeauftragte und spätere Marburger
.Oberbürgermeister Dr. Hanno Drechsler, der uns mit "Herr Kommilitone"
anredete, die Grundlagen der Wissenschaft von der Politik und gab
es im WS 1967/68 ein erziehungswissenschaftliches Proseminar zum
Fremdsprachenunterricht, in dem Dr. Reinhold Freudenstein, damals
Klafki-Assistent, uns eine Vision eröffnete: irgendwann, sagte er, werde
es in jedem Studentenzimmer einen Bildschirm geben, über den
man alle wichtigen Informationen abrufen könne - er war
gerade aus den USA zurückgekehrt.
Ein Meilenstein war, im Frühjahr 1967, zweifellos die
neunwöchige Hospitation an
"meiner" Schule. Mein ehemaliger Deutschlehrer Georg Bonin gab mir seine
Sexta, die durfte ich sechs Wochen völlig frei und selbständig
unterrichten, hernach kamen die lieben Kleinen mit ihren Poesiealben, in
die ich mit Freude kleine Widmungen eintrug; ich wäre damals am liebsten
dort geblieben und hätte weiter unterrichtet. Ganz zum Schluß
etwas damals auch für diese Schule Neues: oben im Physiksaal des Neubaus
präsentierte ich den Amateurfunk, mit meinem Eigenbau-Kurzwellensender
und einer provisorisch über den Schulhof gespannten Langdrahtantenne.
Wieso Amateurfunk? Ich hatte im Sommer 1966 ganz nebenbei Technik, Morsen
und Gesetzeskunde gepaukt und schließlich am 21. Oktober bei der
Oberpostdirektion in Frankfurt meine Funklizenz erworben. Und war kurz darauf
mit meinem Kommilitonen Karl-Heinz Adolph für einen Tag zum HR in Frankfurt
gefahren, wo er als Nachrichtensprecher arbeitete; dieser nur kurze Besuch
inspirierte dazu, von meiner Amateurfunkstelle aus allsonntägliche
Rundspruchsendungen durchzuführen, mit Pausenzeichen, Nachrichten und
Musikeinlagen, Hörberichte kamen auch aus dem Ausland. Zu dieser Zeit
nahm ich teil an einem linguistischen Hauptseminar, in dem es unter anderem
um "Mathematik und Dichtung" ging und komplizierte syntaktische Gebilde nach
allen Regeln der Kunst analysiert wuerden. In der Anglistik hatte ich es
übrigens schon im 3. Semester geschafft, an einem von Kurt Otten geleiteten
Hauptseminar über Chaucers
Canterbury
Tales teilzunehmen.
In jenem noch immer kritischen Jahr 1967, in dem ich rund 3.000 Funkverbindungen
tätigte und an dessen Ende ich mit meinen 24 Jahren Vorsitzender des
DARC-Ortsverbandes Arolsen werden sollte, kam, wie ein Wunder, Josef Kunz'
Vorlesung über Heinrich von Kleist. Das war der endgültige Wendepunkt,
und deswegen gedenke ich noch heute, nach all den vielen wechselvollen Jahren,
dieses so liebenswerten, großartigen und menschlichen Hochschullehrers
ebenso wie meines akademischen Lehrers Ludwig Erich Schmitt, dessen Hauptseminar
über König Rother ebenfalls tiefe Spuren hinterließ. Ebensolchen
Dank schulde ich dem charismatischen Pädagogen Wolfgang Klafki und seiner
Vorlesung über Herbart. Meine pädagogische Zulassungsarbeit
befaßte sich mit der Reform der gymnasialen Oberstufe nach der
Saarbrücker Rahmenvereinbahrung. An einem extrem heißen Junitag
1968 bestand ich mein Pädagogikum und war nun cand.phil. Auf
dem Arolser Marktplatz und an anderen Stellen prangte mein viersprachiges
Plakat "Amateurfunk- Brücke zur Welt" und im Frühherbst 1968 erhielt
ich als erster Arolser die Goldene
Leistungsnadel des Deutschen Amateur-Radio-Clubs.
Was, könnte man nun fragen, hat letzteres mit Wissenschaft zu tun und
warum tut sich ein angehender Deutsch- und Englischlehrer so etwas an? Wieso
das alles, damals schon neun Jahre Erfahrung mit einem
Telefunken-Tonbandgerät, das
ich 1968 bis zur möglichen Grenze umgebaut und in dessen Rahmen mit
der Telefunken AG korrespondiert hatte, wieso die intensive Beschäftigung
mit angewandter Hochfrequenztechnik? Die einzige und, wie ich denke, valide
Rechtfertigung besteht darin, daß ich bereits damals versuchte,
verschiedene Bereiche sinnvoll zu kombinieren und das auf dem einen Feld
an Erfahrungen Gewonnene auf dem anderen Feld einzubringen. Die Gesetze der
funktechnischen Kommunikation "füttern" die nachrichtentechnische
Theoriebildung ebenso wie die Gesetzmäßigkeiten der Ton-Modulation
die praktischen Gegebenheiten der angewandten Phonetik. Letzterer Bereich
blieb mir, was ich immer wieder bedauerte, leider verschlossen. Es sollte
anders kommen, in dieser Kette gesteuerter Zufälle.
Schmitts Hauptseminar über den "König Rother" eröffnete
mir die bislang noch weithin unbekannte Welt der mittelhochdeutschen Dichtung
und speziell die der sogenannten Spielmannsepik. Meine auch hier strukturell
bestimmte Herangehensweise ließ mich das Thema "Sachbeschreibung"
wählen. Hier gibt es klare sprachliche Muster, enorm leistungsfähige
syntaktisch-rhetorische Bauelemente, hier lassen sich klar definierbare Resultate
erarbeiten. Später ermutigte mich Schmitt, diese Forschungen auf die
ganze Spielmannsdichtung auszuweiten, also den Herzog Ernst, den Orendel,
die Oswald-Dichtungen und Salman und Morolf einzubeziehen.
1969, im für mich studienmäßig und nachrichtentechnisch
gleichermaßen interessanten und wichtigen Jahr, führte ich im
Mai unsere Arolser Funkamateure nach Köln (Studios) und Jülich
(Sendeanlage) zur Deutschen Welle, die über gigantisch anmutende
Antennen-Wände schon damals in 35 Sprachen alle Kontinente mit Nachrichten
und kulturellen Features versorgte. Alle Studierenden erlebten eine Sternstunde
der internationalen Raumfahrt und Technikgeschichte, als wir Ende Juli mitten
in einer Vorlesung vernahmen "the Eagle has landed": die ersten zwei Menschen
hatten die Mondoberfläche betreten. Im August erwarb ich für
selbstverdiente 800 DM ein ungeheuer innovativ und vielseitig wirkendes
großes Tonbandgerät, das NordMende 8001/T4, um es auch innerhalb
des Studiums medial einzusetzen; ich nahm es mit ins Englische Seminar,
um dort zusammen mit dem Lektor Hans.Otto Thieme und dem Leiter des
Uni-Sprachlabors die Aussprachetests der Anglistik-Anfänger/innen
auszuwerten. Im Herbst war ich dort Tutor geworden, betreute das
Medienarchiv des Instituts und hielt später selbständige
Grammatik-Übungen im Uni-Sprachlabor.
Horst
Oppel, der ebenfalls unvergessene, international renommierte Nestor der
Marburger Anglistik, hatte den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ihm verdanke
ich Shakespeare-Vorlesungen und eine Altenglisch-Einführung, deren
Eindrücklichkeit für immer in meiner Erinnerung festgeschrieben
sind: das beweist schon die Tatsache, daß ich - im Gegensatz zu vielen
Sprachphänomenen - bestimmte Flexionsendungen des Altenglischen bis
heute nicht vergessen habe - überhaupt spielte die Grammatik schon
immer eine übergeordnete Rolle in meiner sprachlichen Rezeption: das
begann im Deutschunterricht der Sexta und Quinta, setzte sich fort im
Lateinunterricht ab Quarta, war Gegenstand unzähliger Nachhilfestunden,
die ich an den Nachmittagen gab und mit denen ich mir schließlich mein
erstes gutes Mikrofon, das Telefunken D 19 B, finanzierte. Die Sprache als
kreativer Baukasten, als künstlerisches System modularisierter
Elemente, das war immer mein Thema, und das korrespondierte auch mit
meiner technischen Sichtweise, mit Konzeptionen modularisierter Strategien
in der HF- und NF-Technik. Die Theorie war lediglich ein Hilfsmittel, wogegen
es mir immer auf die Praxis ankam: was kann man womit auf optimale
Weise und mit geringstmöglichem Aufwand, also am effektivsten erreichen?
Womit lassen sich Dinge voranbringen, Verhältnisse bessern? Und, das
war mir klar, ergab sich aus aller wissenschaftlicher Beschäftigung,
aus allem Studium die Verpflichtung, das Gelernte alsbald an andere
weiterzugeben - egal wo, ob in der Schule, (wenn überhaupt, das
war noch nicht klar) an der Universität oder in einem anderen Berufsfeld.
Meine Anglistik-Hilfskraft-Tätigkeit bereicherten zwei Ereignisse: die
Teilnahme an einer Sprachlabor-Tagung in Erlangen (Sommer 1969) und einer
mediendidaktischen Tagung im Internationalen Haus Sonnenberg (Frühjahr
1970), wo ich den charismatischen Gelehrten Mario Wandruszka kennenlernen
durfte. Seine damals ironisch formulierte Kritik an Noam Chomskys wohl
ursprünglich als Theoriebasis für Elektronenrechner konzipierter
Transformationeller Grammatik teilte ich damals und teile sie noch
heute; meine ganze Beschäftigung mit Sprache und Literatur habe ich
bis heute immer primär als philologisch (und damit die Sprache
als Kunstwerk) empfunden. Dies half mir auch, eine neue, zunächst
als nicht gerade einfach empfundene, Herausforderung zu meistern, nämlich
Literatur in einer Oberstufe zu unterrichten: diese stellte sich mir
im Marburger Lessing-Kolleg, wo ich zweieinhalb Monate in den
Sommer-Semesterferien arbeitete und Tonbandgerät und Overheadprojektor
als didaktische Hilfsmittel einsetzte.
Wie schon angedeutet, war bislang noch längst nicht klar, wo ich einmal
"landen" sollte. Ab WS 1970/71 hatte ich einen Vertrag als sogenannte
Wissenschaftliche Hilfskraft , arbeitete als solche bis 9/1971 überwiegend
im (noch teils kritisch betrachteten) Uni-Sprachlabor (Prof. Kurt Otten verglich
es 1971 mit einer Melkmaschine) und gehörte zu den wenigen, die
einen Generalschlüssel und damit auch den Zugang zur teuren
Tonband-Kopieranlage besaßen. Dem Internationalen Suchdienst hatte
ich (auch mit etwas Wehmut und schweren Herzens) im April 1970 Ade gesagt,
nun galt es, das Staatsexamen vorzubereiten und, wie von Schmitt vorgeschlagen,
das Sachbeschreibungs-Thema auf alle fünf Spielmannsepen auszuweiten.
Es entstand eine über 400-seitige philologisch-stilistische Analyse
(Schmitt: "Damit hätten Sie bei mir promovieren können"). Nach
einer dreimonatigen Fristverlängerung bestand ich Anfang Juli
1971 das Staatsexamen; unmittelbar danach stellte ich meine schon
damals sehr beachtliche Funkstation um auf Einseitenbandbetrieb und war gerade
dabei, mir ein Netzteil für den Transceiver zu bauen, als Professor
Schmitt aus Marburg anrief und mitteilte, die Bemühungen um eine Stelle
im Sprachatlas seien erfolgreich verlaufen und ich könne im Oktober
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter BAT IIa beginnen. Der ehrwürdigen
Alten Landesschule in Korbach hatte ich einen Besuch abgestattet,
um den Gruß eines Sprachlaborkollegen auszurichten; der Direktor hatte
angedeutet, ein Status als Wissenschaftlicher Mitarbeiter sei doch besser
und angenehmer als wenn ich als Referendar beginnen müßte.
Als selbständige Mitwirkung an Projekten des Instituts wird meine
Tätigkeit vertraglich definiert. Kaum habe ich den Dienst im Deutschen
Sprachatlas begonnen, wird Anfang November 1971 das neue Sprachlabor
der Philipps-Universität im Quergebäude Biegenstraße 12
eingeweiht; aufgrund meiner beratenden Mitarbeit in Sachen
Video-Technik (Ampex-Verfahren) bin ich dazu eingeladen; ein noch
heute im Sprachlabor vorhandenes Presse-Foto zeigt mich neben dem damaligen
Uni-Vizepräsidenten Theodor Mahlmann. Die Sprachlabor-typische
Arbeit mit den 4-Phasen-Drills hat in mir das Konzept eines Abspielverfahrens
mit automatischer Pausen-Tilgung per Vortast-Kopf reifen lassen; die
hohen Kosten halten mich davon ab, es zum Patent anzumelden.
Ich sei doch ein richtiger
Medien-Mann, hatte L.E. Schmitt gesagt,
als ich mich um die DSA-Stelle bewarb. In der Tat. 12 Jahre Erfahrung in
Technik und Praxis der Tonaufnahme, Hospitation beim Rundfunk, mehrere tausend
Funkverbindungen, konstruktionelle Arbeit an Audio- und
Hochfrequenzgeräten, Geschäftsführung in einem Ortsverband
des DARC. Und dazu zwei Jahre Sprachlabor. Ein Medienmann mit wissenschaftlichem
Schwerpunkt in
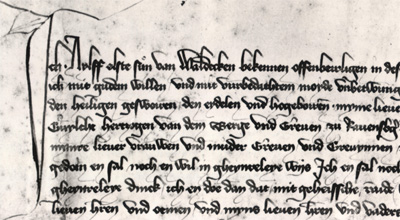 mittelhochdeutscher
Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich
bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:
eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für
mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich
inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,
ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.
Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen
geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine
spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals
von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,
ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über
Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten
Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,
um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten
Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"
auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer
"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals
sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen
Rechtshändeln und -geschäften abspielte.
mittelhochdeutscher
Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich
bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:
eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für
mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich
inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,
ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.
Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen
geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine
spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals
von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,
ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über
Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten
Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,
um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten
Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"
auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer
"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals
sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen
Rechtshändeln und -geschäften abspielte.
Im Frühjahr 1972 erfuhr ich auf einer Tagung zum ersten Mal von
den intensiven, EDV-gestützten Arbeiten zu einem Kleinen Deutschen
Sprachatlas. Jahre später sollten einige Kollegen und ich intensiv
die umfangreichen Computerausdrucke dieses Projekts korrekturlesen.
Gleichzeitig war ich dabei, meine Forschungen zur Sachbeschreibung in den
Spielmannsepen zu einer Dissertation ausweiten. Als übrigens im Oktober
meine erste
Funkfernschreib-Zweiwegverbindung gelang,
war die Konzeption der Diss. unter
Dach und Fach und begannen die ersten Vorbereitungen für den Druck.
Eine Zeit intensiven Arbeitens, kurzer Nächte, eines, wie es Kafka einmal
nannte, wenig regelhaften "Manöverlebens", dessen Nachwirkungen ich
noch im nächsten Frühjahr zu spüren bekam, als ich auf der
Rückfahrt von einer Tagung zusammen mit Prof. Schmitt plötzlich
auf der Autobahn anhalten mußte, weil die Augen so brannten, daß
ich nicht mehr weiterfahren konnte - es dauerte lange, bis dieses Phänomen
sich beruhigt hatte.
Die teils hochkomplizierten Wege und Techniken sachbeschreibender Syntax
zu erkunden und ihre Darstellung zu vertiefen bereitete Freude. Mir, dem
Praktiker, auch und gerade in Sachen Sprache, dem Stilisten und Grammatiker,
der die Sprache begriff als Baukasten zur Herstellung unermeßlich vieler,
kunstvoller, Gedanken, Gefühle, Konzeptionen Gestalt verleihender
Zeichenketten. Mit einem Satz modularer Rotring-Federn entstanden entsprechende
Strukturschemata, mit dem ersten für noch relativ viel Geld angeschafften
elektronischen Tischrechner statistische Berechnungen; nicht vergessen wurde
in einer Anmerkung der Hinweis auf spätere Forschungsmöglichkeiten
mit den damals für linguistische Analysen bereits benutzten
Großrechnern - insofern gelang ein, wenn auch winziger, Spagat zwischen
traditioneller Mediävistik und innovativer Informatik.
Die in großer Eile vollzogene Promotion erwuchs auch aus der
Ungewißheit, Ende 1972 nicht zu wissen, ob der zweite Einjahresvertrag
im nächsten Jahr verlängert werden würde. Gottseidank zerstreuten
sich bald diese Bedenken. Meinem Vorsatz, das wissenschaftlich Erworbene
umgehend weiterzuvermitteln, gehorchte im Sommersemester 1973 meine
erste Lehrveranstaltung zur Sprache in den
Originalurkunden des
13.-15.Jahrhunderts, für die ich auch die spätere Professorin
Dr. Hildegard Stielau von der Randse Afrikaanse Universiteit gewinnen
konnte, die als Institutsgast aus Johannesburg angereist war. Die
organisatorische Durchführung seines Doktoranden- und
Habilitandenkolloquiums hatte mir L.E. Schmitt bereits Anfang 1973 angetragen.
Alsbald beginnen die Vorbereitungen zur für den September geplanten
großen Exkursion der Professoren
Schmitt und Pfister, die uns zu vergleichenden Dialektstudien in die Schweiz
und Oberitalien führt und zu der ich später eine mediengestützte
Nachbereitung präsentiere. Wie schön, dem Schweizerdeutschen
wiederzubegegnen, als ich ein paar Monate später auf einer
Wochenend-Städtereise in Zürich einen Exkursions-Schauplatz wiedersehe
und die Tagung der Schweizerischen Amateurfunk-Fernschreibgruppe
(Swiss-ARTG) besuche.
Trotz der unsicheren Arbeitsvertrags-Lage (Ketten-Jahresverträge) schlage
ich im Frühherbst 1973 die durchaus lukrative und perspektivisch reizvolle
Möglichkeit aus, als Nachfolger des prominenten Nachkriegs-Rundfunkpioniers
und weltbekannten Radioamateurs Egon Koch (DL 1 HM) die Leitung der
Technischen Pressestelle bei der
ITT
zu übernehmen: die Voraussetzungen, nämlich Kompetenzen sowohl
im sprachlich-Journalistischen wie technisch-Ingenieurmäßigen,
erfülle ich ja und hätte diese Stelle aller Voraussicht nach bekommen.
Voller Hoffnung, hier progressive technische Konzepte in die angewandte
Sprachwissenschaft einbringen und realisieren zu können, bleibe ich
in Marburg - und entgehe damit einem ungewissen Schicksal, denn als ich 12
schwierige Jahre später im August 1985 der ITT in Pforzheim
einen Besuch abstatte, um dort mein am umgebauten
SL 700 und auch in Live-Aufnahmen
erprobtes System zur andruckfilzlosen Bandabtastung
("NPT") vorzustellen, werden
nur zwei Jahre vergehen, bis sich der Konzern umstrukturiert.
Im Wintersemester 1973/74 begann ich mit meinen Lehrveranstaltungen zur
mittelhochdeutschen Sprache und Literatur, die meinen Studierenden und mir
große Freude und uns eine Menge interessanter Proseminararbeiten
bescherten. In Ansätzen struktureller und auch interpretatorischer
Sprachbetrachtung konnte ich alles umsetzen und weitergeben, das ich
während des Studiums in Vorlesungen, Übungen und Seminaren gelernt
und in meiner Dissertation erarbeitet hatte. Auf dem technischen Sektor hatte
sich vom Frühjahr 1973 an ein neues, faszinierendes Gebiet eröffnet:
der Kurzwellen-Mobilfunk. Die in
tausenden höchst informativer und technisch interessanter Funkverbindungen
gemachten Erfahrungen führten mich zu dem Vorschlag, der damals bereits
vielfach genutzten Strategie entsprechend für das Institut eine
Amateurfunk-Sonderstation (mit Sonder-Rufzeichen) einzurichten und
in diesem Rahmen nebenher per Funk sowohl Werbung für unsere durchaus
auch modern ausgerichteten Projekte zu machen und ebenfalls per Funk
Dialekt-Erhebungen durchzuführen ("Wie sagen Sie zu XY in Ihrer Mundart?")
Ich beantragte und erhielt ein Sonder-Rufzeichen, für das ich mehrere
Jahrzehnte aus eigener Tasche Lizenzgebühren entrichtete, doch wurde
dem Vorhaben keinerlei Verständnis entgegengebracht, so daß kein
einziger Funkkontakt durchgeführt werden konnte und eine innovative
Konzeption von PR- und Forschungsarbeit ausgeschlagen wurde. Höhepunkt
des Jahres 1974 ist im Juli mein Informations- und Forschungsaufenthalt
in Südafrika, wo ich auch Radio RSA besichtige und in Interviews
meine Eindrücke vermittle.
Konsequent parallel zum Arbeiten an den rechtsgeschichtlichen Sprachzeugnissen
führten meine Lehrveranstaltungen einerseits bis zum
"Sachsenspiegel" und andererseits
im WS 1974/75 zu einem äußerst fruchtbaren Proseminar zur
Historischen Linguistik, das ich auf der Basis ausgewählter Texte
von Notker bis Martin Opitz gestaltete und das eine Reihe interessanter Arbeiten
hervorbrachte. Weitere Lehrveranstaltungen hielt ich zur
Lexikologie, wobei erstmals
ausgewählte Fernschreib-Nachrichtentexte als Lehrmaterialien
benutzt und auch die historischen Aspekte
und die Fachsprachen
gebührend einbezogen wurden, was sich später niederschlagen sollte
in Glossaren zur Luftfahrt- und
Funktechnik. In den Hauptseminaren
L.E. Schmitts, denen ich unterstützend beiwohnte, erlebte ich in aller
Gänze das umfassende, den üblichen Rahmen einer Professur sprengende
Wissen dieses Hochschullehrers, des damals wohl einzigen Lehrstuhlinhabers
für
germanische Sprachen und Literaturen - und damit auch
für das Niederländische; an einigen diesbezüglichen
Prüfungen durfte ich als Protokollant teilhaben: auch hierbei habe ich
Wertvolles gelernt.
Als das Jahr 1975 beginnt, führe ich "meine" Arolser Funkamateure
(nach 1969 zum zweiten Male) zur Deutschen Welle; wir besichtigen die (damals
schon computergesteuerten) Studios in Köln und die imposante Sendeanlage
in Jülich - eine für mich nicht allein technische, sondern auch
medienkundliche Exkursion; in Frankfurt hatten wir zuvor den Hessischen Rundfunk
besucht und auf dem
Hohen
Meißner dessen Sendeanlage in Augenschein genommen. Was die
Dialektologie angeht, so führen im April/Mai 1975 die Professoren Schmitt,
Pfister uns und zahlreiche Gäste in die
Ostalpen; es entstehen zahlreiche
Bild- und Tonaufnahmen; letztere bringe ich, soweit möglich, auch in
die persönliche Lehre ein und integriere später einige in meine
Uni-Homepage. Kurz zuvor hatte unter Leitung von Prof. Reiner Hildebrandt
Institutsmitglieder und Gäste nach Saarbrücken und Metz geführt
und auch hier die Sprachgrenzproblematik deutlich gemacht.
Der konstant innewohnende Wettstreit technisch- ingenieurmäßiger
und sprachlich-struktureller Interessen und die damals personell und
institutionell unsichere Lage erschwerten eine Entscheidung dahingehend,
ob und mit welchem Thema eine Habilitation anzustreben wäre.
Das Faktum, gerade eine der begehrten Dauerstellen bekommen zu haben
und der Plan, eine Familie gründen zu wollen, ließen mich die
Möglichkeit eines kurzzeitigen Habilitationsstipendiums (mit folgender
Stellen-Unsicherheit) ausschlagen; kurz darauf wurde L.E. Schmitt am Ende
des WS 1975/76 emeritiert.
Wertvolle Erkenntnisse bescherte mir Anfang 1976 eine kurze, aber
sehr intensive und alle Aspekte der Empirie vermittelnde Hospitation in der
von Toningenieur Heinz Hopf technisch betreuten Phonetischen Abteilung
des Instituts. Nie vergesse ich das Arbeiten mit den großen
Telefunken-Studiomaschinen, dem Allison-Filter und dem Tempophon. Im Hauptseminar
Prof. Stellmachers in Gießen referierte ich als Gast über Typen
und Erforschung der deutschen Privaturkunden des 13. bis 15. Jahrhunderts
und begann gleichzeitig mit der Anlage einer großen Bibliographie zur
deutschen Lexikologie, in der (später enttäuschten) Hoffnung, diese
mit einem Kollegen zu publizieren. Im Wintersemester 1976/77 hielt ich an
der Universität Gießen vor rund 70 Hörer/innen eine
Einführung in die Historische Linguistik. Das von der Uni Gießen
begrüßte Vorhaben, im SS 1977 dort ein Haupt- und ein Proseminar
zu halten, wurde von Marburg abgeblockt.
Meine sprachlich-strukturellen Interessen vertieften sich in der Lektüre
der groß angelegten, äußerst gründlichen Syntax Otto
Behaghels. Die weitere philologische Beschäftigung mit den Urkunden
und der historischen Rechtssprache führte zu einem Aufsatz in
der Bernhard Martin zum 90. Geburtstag gewidmeten Festschrift, wo ich mich
mit populären Redewendungen (z.B. gang und gäbe) befaßte,
die aus der Urkundensprache erwuchsen. Auch bestückte und betreute ich
eine Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Institutes, das auch
in zwei Symposien gewürdigt wurde.
Ebenfalls im Jahre 1977 erfuhr meine Lehre einen entscheidenden
Neu-Impuls: im neu konzipierten, erstmals von Prof. Thomas Klein geleiteten
Internationalen Ferienkurs der Uni
Marburg arbeitete ich erstmals als Sprach- und Literaturlehrer:
1977 gleich in der Oberstufe
mit Übungen zur Literatur der deutschen Klassik: angesichts meines
bisherigen Arbeitshorizontes auch dies eine besondere Herausforderung, die
ich mit besonderer Freude und Genugtuung annahm: die Interpretation
anspruchsvoller Lyrik und Prosa bereitet Freude und ästhetisches
Vergnügen, und dies versuche ich weiterzugeben. Es folgten acht weitere
Ferien- bzw. Sommerkurse (1978,
1979-1981,
1986, 1990,
1991,
1993); bereits im zweiten (1978)
setzte ich unterstützend auditive Medien ein, referierte im Plenum erstmals
über den Deutschen Sprachatlas und die deutschen Mundarten und
konzipierte Beispieltexte aus der Lyrik
von Klaus Groth.
Um theoretische Grundlagen und die bunte Vielfalt der Mundarten geht es auch
auf dem 6. Kongreß der Internationalen Vereinigung für germanische
Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG), der im August 1980 in Basel
stattfindet und in dessen Rahmen auch ein von meinem Marburger Kollegen Dr.
Kurt Kehr mitbetreuter Dialekt-Workshop uns wertvolle Eindrücke
vermittelt.
Als im selben Jahr eine Kommission zum Deutschen als Fremdsprache
einen entsprechenden Studienplan erstellen soll, reiche ich ein detailliertes
Konzept ein; leider löst sich dieses Gremium bald auf. 1980 bildet sich
ferner eine aus mir und drei weiteren DSA-Kollegen bestehende Arbeitsgruppe,
die sich mit der Transkription von Tonbandaufnahmen zu einem Kleinen Deutschen
Sprachatlas auf phonetischer Grundlage (KDSA-phon) befassen soll; ein
anerkannter Phonetiker vermittelt uns die nötigen Grundlagen. Im
Abhörraum der Phonetik arbeiten wir an Telefunken-Tonbandgeräten
und -Cassettenrecordern und notieren akribisch die in teils mehreren
Hördurchgängen (bei Diphthongen auch per
Rückwärts-Hören) ermittelten Lautphänomene;
exploratorenspezifische
Differenzen sind unvermeidlich.
Meine Erfahrungen auf dem Gebiete der Tonaufnahme und Gerätetechnik
sowie (aktenmäßig dokumentierte) Überlegungen zur Konzeption
eines Spezialtonbandlaufwerks "Transkriptor" bereicherten auch diese
bis zum Frühjahr 1982 ausgeübte Tätigkeit. Mitten in diese
Zeit fällt mein bisher erfolgreichster Internationaler Ferienkurs im
Sommer 1981.
Parallel dazu habe ich, seit Ende 1979, mit dem Aufbau einer auditiven
Mediothek begonnen und dafür bereits weit mehr als tausend Stunden
an wichtigen Rundfunk- und Fernsehbeiträgen aufgenommen und archiviert.
Meine methodischen Überlegungen
dazu münden 1980 im Vortrag "Die auditive 'Mediothek'.
Rundfunk und Tonträger im Dienste sprach- und
literaturwissenschaftlicher Forschung und Lehre" (10.6.,
Fb 08 Allg. und germanistische Linguistik und Philologie, später auch
an der Volkshochschule Frankfurt/Main). Zum Thema und nicht zuletzt aus der
konstruktionellen und restaurativen Beschäftigung mit rund 80 Spulen-
und 60 Cassettentonbandgeräten entstanden ist ebenfalls u.a. ein
rund 500-seitiges Dossier mit Ausführungen zur Geschichte, Praxis und
(z.B. Mikrofon-)Technik solcher
Mediotheken sowie mit Geräte-Informationen. Sprach- und literaturbezogene
Teile des Archiv-Materials kann ich in meine Lehre einbringen.
Die Lage des Institutes zwingt zu einer Neukonzeption und damit zu einer
Teilung in ein Institut I und II, damit auch zu einer Neuberufung des Direktors
für den Deutschen Sprachatlas I. Nach einem für mich in mancher
Hinsicht deprimierenden Jahr kommt im Frühjahr 1983 Prof. Walter
Haas aus der Schweiz nach Marburg; es beginnen damit dreieinhalb Jahre
äußerst anregender, fruchtbarer Beschäftigung mit den deutschen
Mundarten, während der ich u.a. (auch anhand von Tonaufnahmen mit eigenen
Studierenden) ausgesuchte
Hörproben für die zentrale
Haas-Vorlesung erarbeite und aus diesen Proben später zwei vielfach
verschenkte Cassetten erstelle, die auch als mediale Basis zur Führung
von Schulklassen durch das Institut dienen werden. Meine ebenfalls in dieser
Zeit formulierten, auch im Ausländer-Unterricht didaktisierbaren
Vorschläge für "alternative Wenkersätze" finden sich
hier.
Ausgehend von Lehrveranstaltungen zu Wörtern und Wendungen erstelle
ich 1985 und 1986 Hörfunkbeiträge zu kulturell wichtigen
deutschen Wörtern und Wendungen, die im Nordhessenjournal des HR
(Studio Kassel) gesendet werden. Das Jahr 1985, das mir auch rund
90 Live-Konzertaufnahmen beschert,
steht für mich ganz im Zeichen der empirischen Dialektforschung: im
ehemaligen Landkreis Waldeck erhebe ich an vielen Orten (erstmals
auch stereophone) Mundartproben, stelle diese auch im Hessischen Rundfunk
vor und referiere im Volksbildungsring Arolsen über die
waldeckischen Mundarten; eine hieraus
entstandene damalige Ton-Dokumentation findet sich in meiner
Homepage. Alfred Emde aus Adorf, dem ich hier
wiederbegegne, hatte schon 1978
hierzu einen vergleichenden Beitrag geleistet. Die in diesen Jahren geleistete
Arbeit konsolidiert einen meiner wichtigsten Schwerpunkte: die auch in die
Lehre eingebrachte empirische
apparative Feldforschung: hier
kann ich sprachlich-Wissenschaftliches mit allen Erfahrungen auf dem Gebiet
des
apparativ-Ingenieurmäßigen
kombinieren. 1984 trete ich dem
Verband Deutscher
Tonmeister (VDT) bei, besuche im Rahmen meiner Tätigkeit dessen
Tagung in München und bekomme hier wertvolle Anregungen zu
wissenschaftlichen und applikativen Aspekten der Tonaufnahme und -bearbeitung.
Mein seitens der Medienwissenschaft begrüßtes Vorhaben, im WS
1986/87 eine Einführung in die wissenschaftliche Tonaufnahme zu
halten, wird abgeblockt.
Die konstant weiterbetriebene Arbeit an Theorie und Praxis der Tonaufnahmetechnik
führt mich im Oktober 1986 zum Deutschen Blindenbund nach
München, wo ich auf Einladung der Deutschen Blindenhörbücherei
Marburg referiere über Möglichkeiten einer Langzeit-CD
für Blinden-Hörbüchereien. Kurz darauf entsteht mein Aufsatz
"Digitale Sprachaufnahme? Der technische Stand der apparativen
Feldforschung und Sprachdokumentation im Jahre 1987" (in: Elisabeth
FELDBUSCH (Hg.): Ergebnisse und Aufgaben der Germanistik
am Ende des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Ludwig Erich Schmitt
zum 80. Geburtstag)
Das Schicksal des Institutes ändert sich wiederum mit dem höchst
bedauerlichen Weggang Prof. Haas' und dem von der Suche nach einem Nachfolger
bestimmten, ebenso unruhigen wie ungewissen und daher perspektivlos erscheinenden
Interregnum. Im Frühjahr 1987 beginnt unter meiner Leitung die
noch von Walter Haas initiierte, aus seinem Forschungsetat bestrittene und
seitens einer Garmischer Firma mehrjährig durchgeführte
Microfichierung aller rund 40.000
Wenker-Bögen des DSA-Archivs
(das auch die schweizerdeutschen
Bestände einschließt). Interessent/innen des von Prof. Oepen
betreuten Marburger Seniorenstudiums vermittele ich in einer
Führung Einblicke in Arbeitsweisen und Bestände des Institutes.
Ferner arbeite ich an der wissenschaftlichen Betreuung der damals rund 30.000
Bände umfassenden
Institutsbibliothek und erstelle
in diesem Rahmen u.a. eine
Auswahlbibliographie zur angewandten
Dialektologie und Sprachgeographie (bis 1991) - dies mit
bescheidenen computativen Mitteln, denn ich habe im Frühjahr
1988 begonnen, mich intensivst mit der
PC-Arbeit vertraut zu machen, und
autodidaktisch viele Erfahrungen gewonnen, aus denen u.a. im Herbst
1996 ein beratender Text entsteht,
nachdem ich im Rahmen meiner
Personalrats-Tätigkeit (1992-2000)
die beratende Überprüfung der neu eingerichteten
PC-Arbeitsplätze übernommen habe. Die im Frühjahr
1988 erstellte Analyse der Technik
des Cassettenrecorders als Dokumentationsgerät ist kurz darauf Grundlage
eines medienkundlichen Vortrags am Volksbildungsring Arolsen.
Meine Lehre hat sich inzwischen
mit zahlreichen Übungen fast
gänzlich auf das Gebiet des Deutschen als Fremdsprache verlagert
(in die später sogar die
Flugsimulation als landeskundliches
Gestaltungsmittel einbezogen wird). Den mit umfangreichstem Material belegten
(und leider letzten) Sommerkurs halte ich als Lehrer der Oberstufe im Jahre
1993.
Einen wichtigen Meilenstein bildet die völlig selbständige (und
ausschließlich mit eigenen Mitteln vorgenommene) Einrichtung und Gestaltung
meiner Uni-Homepage Mitte Juni 1996. Hier versammeln
sich alle Ergebnisse und Erkenntnisse der persönlichen Forschung und
Lehre; wenn möglich, wurden alle Unterrichtseinheiten dokumentiert,
beispielweise meine ab WS 2002/03 bis Dienstende (2008) gehaltene
Deutsche Landes- und Kulturkunde
oder die Übungsreihe zum Deutsch
im 20. Jahrhundert. Auch meine Arbeiten zum
Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten,
zur Aufbereitung historischer
Tonaufnahmen, zur Digitalisierung
von Tonarchiven und zur Technologie
preisgünstiger Tondokumentationen finden sich hier ebenso wie die
Dokumentation zu Dietmar Seiberts
Lesung aus seinem eigenen Roman, die im November 2007 eine meiner
Lehrveranstaltungen ungemein bereichert.
Mit dem Beginn des Jahres 2000 gelangt unter dem genialen Visionär
Jürgen Erich Schmidt das in einer perspektivlosen Dekade beinahe zum
Archiv zurückgeschrumpfte Institut zu neuer Blüte und wird zu einem
mächtigen, zukunftsorientierten
Forschungszentrum.
Die umfangreichen, von Georg Wenker und seinen Nachfolgern erarbeiteten
Materialien des Deutschen Sprachatlas (Wortliste
hier) werden
digitalisiert
und in allen Teilen und Aspekten der Öffentlichkeit per Internet
zugänglich gemacht. In diese Zeit fallen meine
Gedanken und Daten zur Dialektologie,
meine Übungen zu den deutschen
Dialekten (mit exemplarischer Mundart-Erhebung in der Schwalm)
und mein Mittelseminar zur deutschen
Syntax, bevor ich an der Digitalisierung der DIWA-Tonproben
mitwirke und auch hier wertvolle Erkenntnisse gewinne.
Höhepunkt meiner in bescheidenem Rahmen geleisteten Forschung und Lehre
war sicherlich der am 10. März 2006 auf Einladung an der
Tohoku University in Sendai gehaltene Vortrag zu den deutschen Mundarten,
der sich in voller Länge ebenfalls
hier findet. Mit diesem Vortrag
versuchte ich, alle meine bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem
Gebiete der deutschen Dialekte zu resümieren und, was meines Erachtens
neu ist, die Variation von Sprache mit der von Musik zu vergleichen
- was ich nicht hätte tun können ohne meine in rund 32 Jahren und
1.300 Aufnahmen entstandenen, auch die
praktisch-dialektologische Arbeit befruchtenden Erfahrungen
und Versuche auf dem Gebiet der (mit teils selbst entwickeltem / gebautem
Equipment durchgeführten)
Live-Tondokumentation von Konzerten.
Auch meinen vielen, sympathischen ausländischen Studierenden (mit denen
ich teils noch heute verbunden bin) sind diese Aufnahmen zugute gekommen:
seit deren Beginn (1981) eröffneten ausgewählte Proben daraus meine
Lehrveranstaltungen und ermöglichten auf diese Weise einen bescheidenen
Einblick in die musikalische Kultur unseres Landes und unserer Region.
Ein Fazit
Ich habe hier versucht, anhand bestimmter Daten, Ereignisse und spontaner
Erinnerungen das festzuhalten, was für mich, bis zum Auscheiden aus
dem aktiven Dienst und darüberhinaus, Erfahrung von Wissenschaft bedeutet
hat und weiter bedeutet: in einem Rahmen, der weit über die enge
Begrifflichkeit hinausgeht und der ohne den Einbezug praktischer
Umsetzung nicht auskommt. Wissenschaft ohne Lehre ist für
mich undenkbar (ich kann mir deshalb kaum vorstellen, warum
einige Hochschullehrer die universitäre Lehre als ausgesprochen lästig
empfinden und sie auf ihre Mitarbeiter abwälzen).
Wissenschaft kann und will ich einzig verstehen als eine klar und unzweideutig
vermittelbare Form der Suche nach Neuem, nach Wahrheit. Ihre
Erkenntnisse sollen in keiner Geheimsprache daherkommen, sondern in einer
Form, die möglichst viele Menschen verstehen. Wissenschaft soll weder
ins stille Kämmerlein verbannt stattfinden noch in abgeschlossenen,
elitären Zirkeln, sie soll motivieren, zu eigenständigem
kritischem Denken und fruchtbarem Lernen anleiten, so wie ich es selbst
in bescheidenem Rahmen versucht habe, als Sohn ganz "normaler", unakademischer
Eltern, in vielem überwiegend autodidaktisch lernend und aus
allgemein zugänglichen Quellen.
"Wir", sage ich mal auf meine Generation bezogen, hatten es nicht so einfach
wie die jungen Menschen heute, es gab weder PCs noch Internet, keine Handies,
keine e-Reader, keine digitalen Datenträger und Aufnahmegeräte,
und in Kleinstädten wie Arolsen keine akademischen Institutionen,
allerhöchstens eine bescheidene Stadtbibliothek und / oder ein
Volksbildungswerk. In den Bibliotheken saßen wir tagelang, suchten
mühsam Bücher für eine Bibliographie zusammen, exzerpierten
auf vielen Blättern, bis die Hand wehtat. Unsere Seminararbeiten erstellten
wir ohne Copy & Paste, bescheiden und ehrlich. In den Semesterferien
wurde viel ge"jobbt", für großartige Auslands-Vergnügungsreisen
fehlte das Geld, nur wenige Eltern sponsorten ein Fahrzeug für ihre
studierenden Kinder. Und trotzdem ging es, auch ohne akademischen
Hintergrund, ohne hilfreiche Beziehungen. Es ging, wenn auch manchmal
etwas verschlungen und holprig oder, wie in meinem speziellen Fall, mit
widerstreitenden, ja fast gegeneinander kämpfenden Interessen, einer
nicht gerade karrierefördernden Vielseitigkeit. Klar, die haben es einfach,
die schon mit sechs Jahren wissen, daß sie mal
Universitätsprofessoren werden, denen man jedes Hindernis aus dem Weg
räumt, die deshalb mit jeder Menge Rückenwind auf dieses Ziel
hinarbeiten können und dann von der Gesellschaft als absolute
Senkrechtstarter, als shooting stars bewundert werden.
Die große Ehre, an einer deutschen Universität zu studieren und
einen qualifizierenden Abschluß zu machen, kann jedem zuteil werden,
der, ungeachtet seiner persönlichen Verhältnisse und
entsprechend begabt, sich dazu aufrafft, ordentlich zu leben, in der
Schule gut aufzupassen, fleißig seine Aufgaben zu erledigen und nicht
aufzugeben, ganz gleich, wie es um ihn herum bestellt ist. Bildung ist faktisch
für alle verfügbar, auch wenn aus propagandistischem Mund oft das
Gegenteil behauptet wird.
Ich danke der Universität, aber auch persönlichen, nicht immer
schmerzfreien, Lebenserfahrungen unendlich viel. Und ich möchte mit
meinen bescheidenen Zeilen all diejenigen ermuntern, die trotz vieler
Widerstände einen anspruchsvollen Weg gehen wollen. Denn das Konto im
Kopf ist sicherer als alle Bilanzen und Versprechungen, seien sie noch so
verlockend. Alles, auch das kostbarste, Hab und Gut kann in nur einer Sekunde
zerstört werden, doch das, was man sich selbst erarbeitet hat an Wissen,
Erfahrungen und Erkenntnissen, bleibt ein Schatz, von dem man lange zehren
und den man mit anderen teilen kann.
* -
*
 Alle wichtigen Anregungen und Impulse
erhielt ich an der
Christian-Rauch-Schule
in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.
Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von
kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der
anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich
Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer
schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl
und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich
vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer
Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen
und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines
Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals
für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen
obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen
Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit
viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur
führte.
Alle wichtigen Anregungen und Impulse
erhielt ich an der
Christian-Rauch-Schule
in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.
Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von
kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der
anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich
Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer
schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl
und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich
vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer
Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen
und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines
Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals
für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen
obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen
Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit
viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur
führte.
 Zum Wintersemester 1964/65
wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten
Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für
ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik
immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll
auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen
Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.
Zum Wintersemester 1964/65
wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten
Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für
ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik
immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll
auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen
Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.
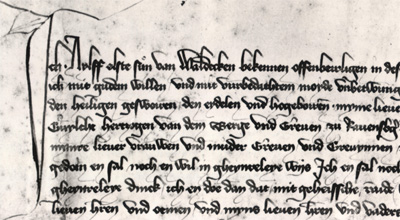 mittelhochdeutscher
Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich
bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:
eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für
mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich
inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,
ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.
Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen
geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine
spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals
von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,
ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über
Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten
Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,
um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten
Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"
auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer
"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals
sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen
Rechtshändeln und -geschäften abspielte.
mittelhochdeutscher
Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich
bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:
eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für
mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich
inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,
ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.
Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen
geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine
spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals
von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,
ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über
Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten
Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,
um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten
Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"
auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer
"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals
sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen
Rechtshändeln und -geschäften abspielte.